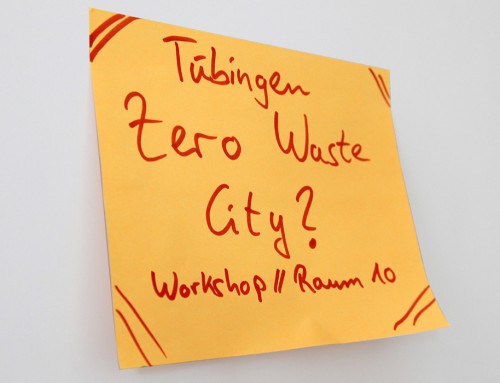Plastikmüll und die Flut an Einwegprodukten sind gerade das Top Thema in vielen Städten. Um die wahren Täter des großen Plastikproblems zu finden, darf man aber nicht nur auf die Konsumenten gucken, sondern muss seinen Blick auch auf die Produzenten und die Abfallindustrie richten. Diese tragen zum wachsenden Müllproblem maßgeblich bei. Kann eine Stadt wie Tübingen die Hersteller zur Verantwortung ziehen und dabei das eigene Plastikproblem lösen?
Das ist gar nicht so einfach, denn der Umgang mit Plastikmüll und Recycling ist nicht kommunal, sondern im gesamten Bundesgebiet durch die Duale System Deutschland GmbH (DSD) geregelt. Die DSD entstand 1991, als eine neue Verpackungsverordnung eingeführt wurde. Unternehmen sollten benutzte Verpackungen ihrer Produkte wieder zurücknehmen und recyclen, hieß es dort. Weil sie dies aber nicht selbst tun wollten, entstand die DSD. Sie befreite die Unternehmen von ihrer Rücknahmepflicht und organisierte das für sie.
Fehlwürfe und energetische Verwertung
Seitdem sollen Bürger ihre Kunststoffverpackungen im „Gelben Sack“ sammeln. Und je besser die Bürger ihren Müll trennen, desto besser stehen die Chancen, dass die Verpackungen aus dem „Gelben Sack“ tatsächlich recycelt werden können. Jedoch fehlt es ihnen häufig an Wissen über die richtige Trennung, da es regionale und nationale Unterschiede gibt. Dadurch kommt es in Städten wie Tübingen, in denen viele internationale Studierende leben, häufiger zu sogenannten Fehlwürfen.
Bei Fehlwürfen, also falsch einsortiertem Müll, wird oft der ganze Sack verworfen. Auch in den Sortieranlagen werden manche Verpackungen nicht erkannt und aussortiert. Durch diese und andere Faktoren führen dazu, das ein großer Teil des Plastikmülls „energetisch verwertet“, also verbrannt wird.
Tricksen mit Recyclingquoten
Offiziell sind die Recyclingquoten in Deutschland relativ hoch. Diese beziehen sich jedoch nur auf die Anlieferung bei den Recyclingunternehmen, nicht aber auf den recycelten Output. Der ist niedrig: Nur ein Sechstel der Verpackungsabfälle wird in Deutschland recycelt und kann so wieder in den Kunststoffkreislauf eingespeist werden. Denn sobald verschiedene Kunststoffarten in einer Verpackung gemischt sind (etwa bei Verbundverpackungen wie Tetrapak), ist das Recycling nicht mehr möglich. Außerdem sind recycelte Kunststoffe schlechter in ihrer Qualität. Darum wird von Herstellerseite lieber auf neue Kunststoffe zurückgegriffen, die deutlich preisgünstiger sind als recycelte Materialien.
Es ist eine komplexe Situation, trotzdem sitzt das eigentliche Problem am Anfang der Abfallkette. Produkt- und Lebensmittelhersteller nutzen weiterhin Verpackungen aus Plastik – warum auch nicht? Die Verantwortung für die Entsorgung haben sie an die DSD abgegeben, und ohne Druck von außen werden die Hersteller ihre Verhaltensweise auch nicht ändern.
Was kann eine Stadt wie Tübingen tun?
Sie könnte ihre Läden unterstützen. In vielen Städten – auch in Tübingen – gibt es mittlerweile Unverpackt-Läden, in denen man Dinge ohne Plastikverpackung einkaufen kann. Warum unterstützt die Stadt solche Einkaufmöglichkeiten nicht? So könnte sie den Herstellern zumindest indirekt, durch zurückgehende Verkaufszahlen, den Weg in Richtung plastikfreie Verpackung weisen.
Tübingen könnte seine Bewohner zu einem plastikfreien Kaufverhalten animieren und dafür belohnen. Auch so könnte die Stadt etwas bewegen und indirekt Druck ausüben. Ob Tübingen diese Möglichkeiten in absehbarer Zeit nutzen wird, bleibt allerdings offen.
Text: Katrin Wernicke
Foto: Peter Clarkson/unsplash
14.07.2019